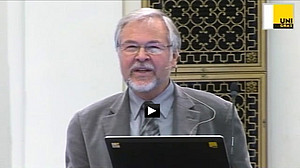Vorträge zum Leitthema „Der Alltag: Sensationen des Gewöhnlichen“
Was macht den Alltag sensationell? Das Gewohnte und Alltägliche ist normalerweise nicht der Rede wert, wir schenken ihm keine besondere Beachtung. Schaut man jedoch genauer hin, offenbaren sich auf den ersten Blick verborgene Besonderheiten und Bedeutsamkeiten, ja sogar Spektakuläres. Das Vortragsprogramm der Montagsakademie lädt Sie zu einer Reise durch die unterschiedlichsten Bereiche des Alltags ein. Renommierte WissenschaftlerInnen gewähren überraschende Einblicke in ihre aktuellen Forschungsbereiche. Das Werden und Vergehen allen Lebens wird dabei ebenso in den Blick genommen wie Beruf und Schule, das Thema Menschenrechte im Alltag oder verborgene Mechanismen in der Pflanzen- und Tierwelt.
Aufzeichnung der Montagsakademie vom 20.10.2014
"Die Normalität des Alltags: Vom Verschwinden des Gewöhnlichen"
Univ.-Prof. Mag. Dr. Manfred Prisching, Institut für Soziologie, Universität Graz
Normalität ist das, was wir für normal halten. Sie ist etwas Gemeinsames, aber oft schwer zu entziffern. Sie ist allgegenwärtig, aber in gewissem Sinne unsichtbar: Das, was selbstverständlich ist, nehmen wir meist nicht wahr. Normalität macht uns zu schaffen: Unterschiedliche Normalitätsvorstellungen können kollidieren, etwa zwischen Ethnien und Kulturen, und das Alltägliche kann sich so rasch verändern, dass uns das, was noch vor wenigen Jahren selbstverständlich war, lächerlich vorkommt. In der pluralistischen, individualistischen und flexiblen Spätmoderne steht das Prinzip der Normalität jedoch überhaupt in Frage: Können wir gemeinsame Normalität definieren? Wird Normalität zur bloßen Mittelmäßigkeit, zur Langeweile, zur Charakteristik der Verlierer? Sind normale Menschen unbrauchbar? Und letztlich: Ist eine Gesellschaft ohne Normalität möglich?
Aufzeichnung der Montagsakademie vom 03.11.2014
"Warum verunsichert uns das Sterben? Medizinische und moralische Aspekte"
Univ.-Prof. DDr. Walter Schaupp, Institut für Moraltheologie, Universität Graz
Biologisch ist der Tod das selbstverständliche und unausweichliche Ende jedes organismischen Lebens, auch des menschlichen. Über Jahrhunderte waren Sterben und Tod in kulturelle Bräuche und religiöse Rituale eingebettet, die Sicherheit gaben. Der Fortschritt der Medizin, der gestiegene Wohlstand und die gewachsenen Möglichkeiten der Selbstbestimmung haben das Sterben paradoxer Weise für den Menschen nicht leichter gemacht, sondern schwieriger. Vielfältige Auseinandersetzungen um Hirntod, Patientenverfügungen, Demenz und um assistierten Suizid zeugen von der Angst des Menschen, einmal keinen „guten Tod“ sterben zu können. Jede eindimensionale Erklärung für dieses Phänomen greift zu kurz. Es sind sehr vielfältige Faktoren, die zu dieser Verunsicherung beitragen. Sie zu verstehen stellt die erste Voraussetzung dafür dar, mit Sterben und Tod angstfreier und souveräner umgehen zu können.
Aufzeichnung der Montagsakademie vom 17.11.2014
"Die Mikrowelt von Pflanzen – eine Sensation?"
Univ.-Prof. Dr. Gabriele Berg, Institut für Umweltbiotechnologie, Technische Universität Graz
Während einzelne Mikroorganismen bereits nach der Erfindung des Mikroskops im 17. Jahrhundert durch Antoni van Leeuwenhoek sichtbar gemacht werden konnten, blieben die Identität der einzelnen Mikroorganismen sowie die Struktur komplexer Gemeinschaften aus ihnen lange Zeit unbekannt. Erst Ende des 20. Jahrhunderts wurden molekulare Techniken entwickelt, die diese Black Box öffnen konnten. Studien, die in den letzten 10 Jahren durchgeführt wurden, ergaben eine hohe Anzahl von überraschender Vielfalt in den mikrobiellen Ökosystemen: im menschlichen Darm leben mehr als 100 Trillionen Mikroorganismen; in der Pflanzenwurzel, die ähnlich wie unser Darm der Nährstoffaufnahme dient, leben mehr Mikroorganismen, als Menschen auf der Erde. Die komplexen Mikroorganismengemeinschaften werden als Mikrobiome bezeichnet. Pflanzen werden nun im Zusammenhang mit ihren Mikroorganismen gesehen: ohne sie sind viele nicht in der Lage zu keimen, zu wachsen oder wohlschmeckende Früchte zu bilden. Interessanterweise gibt es einen Zusammenhang zwischen Mikrobiomen: unsere Nahrung bestimmt nicht nur indirekt über ihre Zusammensetzung unser eigenes, individuelles Mikrobiom, sondern dient auch direkt als wichtige Quelle für nützliche Mikroorganismen. Die Erkenntnisse der letzten Jahre führten zu einer Neubewertung von Pflanzen als Gesamtlebewesen mit Konsequenzen für die Landwirtschaft, die Ökosystemforschung und die menschliche Gesundheit.
Aufzeichnung der Montagsakademie vom 1.12.2014
„Menschenrechte. Worauf kommt es im Alltag an?"
Univ.-Prof. Mag. Dr. Wolfgang Benedek, Institut für Völkerrecht und Internationale Beziehungen, Universität Graz
Sind Menschenrechte für den Alltag bestimmt? Tatsächlich sind Menschenrechte nur dann sinnvoll, wenn sie auch im Alltag wirksam werden. Sie können nicht nur für den Staat, sondern auch im Verhältnis der Menschen untereinander wertvolle Orientierung geben. Am Beispiel der Menschenrechtsstadt Graz und einer in Vorbereitung befindlichen Menschenrechtsregion Steiermark soll gezeigt werden was Menschenrechte im Alltag bedeuten. Dabei geht es um die Fähigkeit Menschenrechtsprobleme zu erkennen, Menschenrechtsverletzungen zu vermeiden, sich gegen Verletzungen der Menschenrechte zur Wehr setzen zu können, und, wenn notwendig, Hilfe zu finden. All dies ist Teil der Menschenrechtsbildung, die daher zu einem guten Zusammenleben beitragen kann.
Aufzeichnung der Montagsakademie vom 12.1.2015
"Unser tägliches Brot – wie die Ernährung Gesundheit und Altern beeinflusst"
Univ.-Prof. Dr. Frank Madeo, Institut für Molekulare Biowissenschaften, Universität Graz
In seinem Vortag geht Professor Madeo auf die grundlegenden Theorien des Alterns ein und erklärt diese sowohl an einfachen biologischen Modellen als auch am Menschen. Außerdem nennt er die rasantesten Altersbeschleuniger, hinterfragt die bekanntesten Anti-Aging Märchen und geht schließlich auf wissenschaftlich fundierte Strategien ein, die das Altern eventuell verzögern. In diesem Zusammenhang werden unterschiedliche Nahrungsmittel und Diäten und deren Einfluss auf Gesundheit und Fitness wissenschaftlich geprüft.
Aufzeichnung der Montagsakademie vom 26.1.2015
"Nachkriegszeiten. Gewalt als Teil des Alltags 1918 – 1920"
O.Univ.-Prof. Dr. Dr.h.c. Helmut Konrad, Institut für Geschichte, Universität Graz
Der Erste Weltkrieg hat gut 10 Millionen Menschen das Leben gekostet. Aber Gewalt und Töten gingen auch nach den Waffenstillständen und Friedensverträgen weiter. Rund 4 Millionen Menschen wurden in den 3 Jahren, die auf den Krieg folgten, zu Opfern physischer Gewalt und verloren ihr Leben. Die Gesellschaften waren brutalisiert, die Staaten hatten das Gewaltmonopol verloren und sahen sich mit bewaffneten Gruppierungen der unterschiedlichsten Art konfrontiert.
Aufzeichnung der Montagsakademie vom 20.4.2015
„Routinen, Intuition und unbewusstes Denken: Autopiloten für den Alltag"
Univ.-Prof. Dipl.-Psych. Dr. Katja Corcoran, Institut für Psychologie, Universität Graz
Der Alltag ist überwältigend. Informationen und Bilder strömen auf uns ein und wollen verarbeitet werden, tausend Dinge sind zu erledigen und ununterbrochen haben wir die Wahl, uns für dieses oder jenes zu entscheiden. Wie schaffen wir es da, uns von dem Alltag nicht überwältigen zu lassen? Welche Strategien hat der Mensch entwickelt, um den ganz gewöhnlichen Anforderungen des Alltags gewachsen zu sein und dabei nicht ständig an seine oder ihre mentalen Grenzen zu stoßen? In meinem Vortrag werden ich Ihnen den Autopiloten der Menschen vorstellen, der uns in der Regel sicher durch den Alltag steuert und uns viele Entscheidungen abnimmt, ohne dass wir uns dessen bewusst sind oder wir groß darüber nachdenken.
Aufzeichnung der Montagsakademie vom 4.5.2015
„Soziale Cyborgs: Maschinen und Lebewesen verschmelzen zu Super-Gesellschaften"
Assoz.-Prof. Mag. Dr. Thomas Schmickl, Institut für Zoologie, Universität Graz
In ihrer Wahrnehmung, Bewegung und der Koordination sind Tiere allen heute verfügbaren Robotern haushoch überlegen. Vor allem wenn es um das Zusammenwirken in der Gruppe geht, können sich die Ingenieurwissenschaften viel Nützliches von natürlichen Organismen abschauen. Aber auch in der anderen Richtung funktioniert diese Wechselwirkung: Roboter (autonome Attrappen) helfen heute vermehrt in der Forschung, um tierisches Verhalten (v.a. soziale Interaktion und Kommunikation) zu erforschen: Es werden autonome Roboter gezielt in tierische Gesellschaften eingeschleust und verhalten sich dort wie ihre tierischen MitspielerInnen. Durch diese Methode lassen sich Interaktionsmodelle überprüfen und Interaktionsmuster automatisiert aufzeichnen. Der Vortrag gibt einen kurzen Überblick über aktuelle Entwicklungen und stellt insbesondere das heuer gestartete EU-Forschungsprojekt ASSISI_bf vor, bei dem ein Roboterschwarm und ein Bienenschwarm zu einer funktionellen Einheit verschmolzen werden.
Aufzeichnung der Montagsakademie vom 18.5.2015
"„Gefühle in Zeiten der Professionalisierung“ – Über blinde Flecken der Pädagogik und ihre Folgen für die Schule"
Univ.-Prof. Mag. Dr. Agnieszka Czejkowska, Institut für Pädagogische Professionalisierung, Universität Graz
Der gesellschaftliche Wandel führt zu Aushandlungsprozessen der Arbeitsteilung, die so weitreichend sein können, dass mitunter neue Berufe entstehen. Neue Betätigungsfelder wie jene der Schulpsychologie und Schulsozialarbeit oder so genannte BegleitlehrerInnen sind kein Zeichen von progressiven Schulmanagement, sondern - wenn es die Mittel erlauben - selbstverständlich. Schulen und ihre AkteurInnen erschaffen auf diese Weise einen Handlungsbereich, in dem frei nach Eva Illouz psychische Gesundheit als zentrales Gut zirkuliert. Eine neue Form der Kompetenz rückt damit nahezu unbemerkt ins Zentrum: die emotionale Kompetenz. Sie ermöglicht oder sie disqualifiziert, jedenfalls verteilt sie diskret und von der Pädagogik unberücksichtigt die ökonomische und soziale Teilhabe.
Aufzeichnung der Montagsakademie vom 8.6.2015
„Geschlechterkampf im Arbeitsalltag"
Univ.-Prof. Dr. Renate Ortlieb, Institut für Personalpolitik, Universität Graz
Warum trägt die Flugbegleiterin einen Rock und die Pilotin einen Hosenanzug? Warum sprechen Männer in Meetings mehr als Frauen? Und was passiert beim jährlichen Sommerfest des Betriebs? Der Arbeitsplatz ist nicht nur ein Ort, an dem Produkte hergestellt und Dienstleistungen erbracht werden. Sondern hier werden stets auch Geschlechter-Identitäten verordnet, ausgehandelt und gelebt. Nicht zuletzt hängt damit auch zusammen, dass Frauen weniger verdienen als Männer, und dass sie seltener Führungspositionen innehaben. Der Vortrag beleuchtet sowohl die deutlicher sichtbaren wie auch die stärker verborgenen Praktiken und Symbole, in denen sich Geschlechterordnungen im Arbeitsalltag manifestieren und durch die gleichzeitig die bestehenden Geschlechterordnungen reproduziert – oder auch verändert – werden.
© Das Verwertungsrecht liegt bei der Karl-Franzens-Universität Graz. Alle Rechte vorbehalten.
Die Nutzung der Montagsakademie-Onlinevideothek ist nur unter den Bedingungen der Creative Commons-Lizenz „BY-NC-ND 3.0“ gestattet. Kommerzielle bzw. sämtliche nicht-private Nutzung, öffentliche Vorführung, Reproduktion und Verwendung auf anderen Websites ist untersagt. Veröffentlichungsjahre 2009 bis 2025. Das geistige Eigentum und die Verantwortung über die Inhalte der Vorträge liegen bei den Vortragenden.