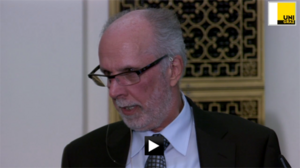Vorträge zum Leitthema „Wie frei ist unser Wille?“
„Sie haben die Wahl!“, heißt es oft in der Werbung. Können wir uns aber wirklich aus freien Stücken für oder gegen etwas entscheiden? Inwieweit werden wir durch Kräfte bestimmt, die wir nicht beeinflussen können und innerhalb welcher Grenzen sind wir Herr/in unseres Schicksals? Das sind Fragen, die unser Denken schon seit geraumer Zeit beschäftigen und die sich angesichts neuer Erkenntnisse wie zum Beispiel der Hirnforschung wieder neu stellen. VertreterInnen verschiedener Wissenschaftsdisziplinen wie z. B. Philosophie, Theologie, Erziehungswissenschaften oder Ökonomie werden sich im diesjährigen Programm der Montagsakademie mit dem Thema der Willensfreiheit beschäftigen.
Aufzeichnung der Montagsakademie vom 19.10.2015
"Wie frei sind unsere Gefühle? Neurowissenschaftliche Zugänge zur Erforschung von Emotionen und deren Regulation"
Univ.-Prof. Dr. Anne Schienle, Institut für Psychologie, Universität Graz
Wie schnell kommen und gehen Gefühle? Wie automatisiert bzw. kontrolliert läuft unser Gefühlsleben ab? Können Gefühle krank machen? Sind Gefühle therapierbar? Dies sind einige der Fragestellungen, die im Vortrag geklärt werden sollen, wobei eine neurowissenschaftliche Perspektive eingenommen wird. Mit Hilfe von sogenannten bildgebenden Verfahren (Neuroimaging) kann die Gehirnaktivierung während emotionaler Prozesse untersucht werden, um deren Eigenschaften besser zu verstehen.
Aufzeichnung der Montagsakademie vom 9.11.2015
"Wille, Geist, Gehirn – und wo bleibt die Freiheit? Von den Grenzen der Selbstbestimmung und ihren Folgen"
Univ.-Prof. Dr. Peter Strasser, Institut für Rechtsphilosophie, Rechtssoziologie und Rechtsinformatik, Universität Graz
Seit jeher haben die Naturalisten behauptet, dass alles entweder eine physische Ursache habe oder eben zufällig geschehe, auch die scheinbar selbständigen, wohlüberlegten Entscheidungen. Heute behaupten viele Hirnforscher, dass sie in der Lage seien, mit ihren Methoden den naturalistischen Standpunkt zu belegen. Demnach würden nicht wir selbst unseren Willen oder Geist steuern. Der große Steuermann wäre vielmehr unser Gehirn. Im Vortrag wird gezeigt, dass wir ohne Freiheitsunterstellung nicht auskommen, solange wir einander als verantwortliche Individuen begreifen – als autonome Subjekte, die zu moralischem Handeln fähig sind. Es gibt eine Alltagsmetaphysik der Person, welcher die Wissenschaft blind gegenübersteht. Deshalb wird zwischen Philosophen und Hirnforschern oft aneinander vorbeigeredet. Beide streben nach einer Lösung, die Frage der „Willensfreiheit“ lässt sich jedoch weder durch Erfahrungsbefunde noch durch rein begriffliche Argumente entscheiden. Sie ist unabweisbar und zugleich rätselhaft.
Aufzeichnung der Montagsakademie vom 23.11.2015
"Mündige BürgerInnen, souveräne KonsumentInnen: Von den Grenzen der Selbstbestimmung und ihren Folgen"
Univ.-Prof. Mag. Dr. Richard Sturn, Institut für Finanzwissenschaft und Öffentliche Wirtschaft, Universität Graz
Verbot harter Drogen, Schulpflicht, Sachtransfers anstelle von Geldleistungen für einkommensschwache Familien, Gurten-, Helm- und sonstige Pflichten zum Selbstschutz und zur Vorsorge. Dies alles sind staatliche Maßnahmen, die grundlegenden Annahmen des marktwirtschaftlichen Liberalismus widersprechen: Menschen mit freiem Willen wissen selbst am besten, was für sie gut ist. Wird ihnen Eigenverantwortung abgenommen, verkümmert ihre Fähigkeit zur Selbstbestimmung. Pauschalangriffe gegen staatlich verordnete Entmündigung führen nicht weiter. Viele finden die genannten Maßnahmen vor dem Hintergrund ihrer Lebenserfahrung plausibel. Wie aber grenzt man plausible Maßnahmen zum Vorteil vieler von Bevormundung und Paternalismus ab? Und inwiefern ist der Umstand relevant, dass Menschen nicht nur KonsumentInnen sind, sondern in einer Demokratie die Rahmenbedingungen mitgestalten? In diesem Vortrag werden Beispiele (Alterssicherung) diskutiert und Befunde der experimentellen Ökonomik und neuere Ansätze wie jenes des Libertären Paternalismus vorgestellt. Diese bieten eine differenzierte und konstruktive Perspektive auf Fragen der Selbstbestimmung und ihrer Grenzen, die ebenso heikel wie grundlegend sind.
Aufzeichnung der Montagsakademie vom 30.11.2015
„Was ist Sucht? Abhängigkeit, Bindung und Freiheit"
Prim. Univ.-Prof. DDr. Michael Lehofer, Leiter der Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie 1, LKH Graz Süd-West
Bindung und Freiheit sind Grundbedürfnisse des Menschen. In der Alltagsrealität wird Bindung nicht selten als Hindernis für Freiheit und die Möglichkeit zur Freiheit nicht selten als Mangel an Bindung erlebt. Dabei ist Bindung die Grundvoraussetzung von Freiheit, sich frei zu fühlen also ein Marker für das Verbundensein. Sucht ist eine Konsequenz von Frustrationen der genannten Grundbedürfnisse. Abhängigkeit entsteht durch die Möglichkeit mittels Substanzen oder Verhaltensweisen kurzfristig das Empfinden von Freiheit und Bindung zu erzeugen. Während des süchtigen Erlebens und Verhaltens müssen wir unsere basalen Frustrationen in Bezug auf Bindung und Freiheit nicht schmerzhaft erleben.
Aufzeichnung der Montagsakademie vom 11.1.2016
"Liebeswahl oder Liebesbestimmung? Goethes „Wahlverwandtschaften“ und ihre Fortschreibung in der Gegenwartsliteratur"
Ao.Univ.-Prof. Dr. Günter Höfler, Institut für Germanistik, Universität Graz
Wie frei ist unsere Liebeswahl? Worin besteht die Macht erotischer Anziehung und wie geht eine Gesellschaft mit dieser im Grunde anarchischen, ‚magnetischen‘ Kraft um? Diese Fragen stellt Goethe ins Zentrum seiner Wahlverwandtschaften und erweitert sie zu einer Hinterfragung der menschlichen Bedingtheit schlechthin. Seine Handlungskonstellation der Liebesverstrickung von vier Personen, die die vielfältigen Gefühls- und Motivationslagen der Figuren offenlegt, ist auch höchst ergiebig für eine heutige literarische Befragung unserer Liebeskonstellationen und deren Zustandekommen. Die Fragen bleiben die gleichen, die Liebesvorstellungen und die literarischen Antworten sind selbstredend andere. Dies soll anhand von zeitgenössischen Romanen von Dieter Wellershoff, Christa Schmidt, Uwe Timm, Ulrich Woelck u.a. illustriert werden, die sich alle am Goetheschen Modell orientieren.
Aufzeichnung der Montagsakademie vom 25.1.2016
"Fortpflanzungsmedizin, Sterbehilfe und die Grenzen der persönlichen Freiheit"
Ao.Univ.-Prof. Dr. Erwin Bernat, Institut für Zivilrecht, Ausländisches und Internationales Privatrecht, Universität Graz
Seit geraumer Zeit stehen die regulativen Probleme von Fortpflanzungsmedizin und Sterbehilfe nicht nur im Mittelpunkt der medialen Berichterstattung, sondern auch von Ethik und Jurisprudenz. „Verhaltensweisen, die der Gesetzgeber nicht verboten hat, sind dem Bürger im weitgehend liberalen, demokratischen und den Grundrechten verpflichteten Verfassungsstaat an sich erlaubt.“ Daraus folgt die Binsenweisheit: Einschränkungen der allgemeinen Handlungsfreiheit müssen einem mehr oder weniger „harten“ Plausibilitätstest unterzogen werden. Welche Gründe indes die Einschränkung der allgemeinen Handlungsfreiheit am Anfang (Fortpflanzungsmedizin) und am Ende des menschlichen Lebens (Sterbehilfe) rechtfertigen, ist heute umstrittener denn je. Verletzt die Leihmutterschaft die Würde der gebärenden Frau, die sich – meist gegen Entgelt – verpflichtet, das Kind der Wunscheltern auszutragen und es ihnen nach seiner Geburt zu „überlassen“? Haben Kinder, die durch gespendeten Samen geboren werden, ein Recht, ihren leiblichen Vater kennenzulernen? Soll dem ernstlichen und eindringlichen Wunsch eines sterbenskranken Menschen, getötet zu werden, entsprochen werden? Dürfen dem hirntoten Patienten Organe entnommen werden, um die Gesundheit eines anderen Menschen wiederherzustellen oder gar sein Leben zu retten? Erwin Bernat hinterfragt in seinem Vortrag die ethische Legitimität diverser Rechtsregeln und behandelt die Frage, wie der Gesetzgeber in einem Zeitalter des ethischen Pluralismus zu Lösungen finden kann, die sich als die „am wenigsten schädliche Alternative“ erweisen.
Aufzeichnung der Montagsakademie vom 14.3.2016
„Wie haben politische, kulturelle und religiöse Ideologien Menschen im 20. Jahrhundert manipuliert?"
Ao.Univ.-Prof. Dr. Karin Maria Schmidlechner-Lienhart, Institut für Geschichte, Universität Graz
Ausgehend von Überlegungen, dass die Vorstellung vom freien Willen sowohl auf individueller als auch auf gesellschaftlicher Basis wissenschaftlich nicht fundiert ist und dass das menschliche Verhalten, Denken und Fühlen gewissen Mechanismen unterliegt und von außen beeinflussbar ist, werden in diesem Vortrag jene Manipulationsstrategien, die sich besonders für die Beeinflussung von gesellschaftlichen Gruppen eignen, vorgestellt. Ein besonderes Augenmerk wird dabei auf die Rolle der Medien gelegt. Anhand von konkreten Beispielen aus Politik, Kultur und Religion wird gezeigt, dass, aus welchen Gründen und in welchen Dimensionen solche Strategien in der Beeinflussung von Gesellschaften tatsächlich sehr erfolgreich waren und noch immer sind. Im Anschluss daran sollen Gegenstrategien diskutiert werden.
Aufzeichnung der Montagsakademie vom 11.4.2016
„Lebenslanges Lernen: Zwischen Müssen, Wollen und Können"
Univ.-Prof. Dr. Elke Gruber, Institut für Erziehungs- und Bildungswissenschaft, Universität Graz
Das Konzept des Lebenslangen Lernens ist in den letzten Jahren in aller Munde. Es gilt als die Problemlösungsstrategie für eine Gesellschaft im Wandel. Im Vortrag geht es um die Ambivalenzen, die mit dem Konzept des Lebenslangen Lernens verbunden sind. Lernen-Müssen weist auf die gesellschaftliche, vor allem arbeitsmarktpolitische Notwendigkeit von Weiterbildung hin. Lernen-Wollen spricht die Tatsache des freien Willens an, nachdem Lernen für Menschen ein sehr erfüllendes, befriedigendes Erlebnis sein kann. Lernen-Können – hier geht es um Fragen der Teilhabe am Lernen in ihren unterschiedlichen Dimensionen.
Aufzeichnung der Montagsakademie vom 25.4.2016
"Klischees und Stereotype – wie sie unser Denken, Lernen und Handeln beeinflussen"
Univ.-Prof. Dipl.-Psych. Dr. Manuela Paechter, Institut für Psychologie, Universität Graz
Stereotype und Klischees sind vereinfachte, schablonenartige Vorstellungen, die Menschen von anderen Personengruppen bilden. Weder beruhen sie auf Erfahrungen noch entsprechen sie der Realität. Sie beeinflussen, wie Menschen andere wahrnehmen, z.B. ob ein Kind von seinen Lehrer/inne/n für begabt gehalten wird oder ob ein Erwachsener glaubt, einer fremden Person vertrauen zu können. Stereotype beeinflussen nicht nur, wie man andere, sondern auch wie man sich selbst wahrnimmt. Sie können Menschen daran hindern, ihre Potentiale zu erkennen und auszuschöpfen. Die Entstehung von Stereotypen hat meist eine lange Entwicklungsgeschichte, an der nicht nur Eltern und Freunde, sondern auch Medien wie Fernsehen oder Internet beteiligt sind.
Aufzeichnung der Montagsakademie vom 9.5.2016
„Wie frei ist unser Wille zu mehr Nachhaltigkeit?"
O.Univ.-Prof. Dr. Friedrich M. Zimmermann, Institut für Geographie und Raumforschung und RCE Graz-Styria: Regionales Zentrum für Nachhaltige Entwicklung, Universität Graz
Das Thema widmet sich den aktuellen Herausforderungen der Globalisierung und geht der Frage nach, inwieweit wir in einer dem Diktat des globalisierten Konsums ausgelieferten Gesellschaft das Wort Nachhaltigkeit überhaupt in den Mund nehmen dürfen. Wie frei ist unser Wille für einen nachhaltigen Umgang mit Ressourcen, für ein nachhaltiges Wirtschaften, für eine gerechte(re) (Welt-) Gesellschaft und damit für ein nachhaltiges Leben? Praxisfälle und Gedankenspiele zeigen Optionen – aber auch Barrieren (im Sinne des nicht-freien Willens) – für eine nachhaltige Entwicklung, die allen Menschen Chancen auf ein zukunftsfähiges Leben eröffnen. Individuelle und kollektive (Bewusstseins)Bildung für Nachhaltigkeit ist für alle, die zu einem nachhaltigen Globalen Wandel beitragen möchten, oberstes Gebot – und hier haben wir auch unseren freien Willen, einen individuellen Beitrag „vom Umdenken zum Umhandeln“ zu leisten.
Aufzeichnung der Montagsakademie vom 23.5.2016
„Ende der Freiheit? Zur Kritik eines philosophischen Begriffs durch die Hirnforschung"
Univ.-Prof. DDr. Reinhold Esterbauer, Institut für Philosophie an der Katholisch-Theologischen Fakultät, Universität Graz
Wer handelt – ich oder mein Gehirn? Gibt es überhaupt ein freies Ich, oder bestimmt das Gehirn mein Verhalten? Einige Vertreterinnen und Vertreter der Neurowissenschaften gehen davon aus, dass die Willensfreiheit des Menschen eine Selbsttäuschung oder eine kulturell entstandene Illusion sei. In Wirklichkeit „entscheide“ das Gehirn, was jemand tut, aber nicht der einzelne Mensch selbst. Im Vortrag wird gezeigt, wie man zu solchen Äußerungen kommt, die Begriffe wie „Willensfreiheit“ und „Ich“ als veraltet erscheinen lassen. Es geht darum aufzuzeigen, dass solche Positionen Annahmen voraussetzen, die alles andere als selbstverständlich sind. Darüber hinaus werden Gründe erläutert, die für die Freiheit des Menschen sprechen.
© Das Verwertungsrecht liegt bei der Karl-Franzens-Universität Graz. Alle Rechte vorbehalten.
Die Nutzung der Montagsakademie-Onlinevideothek ist nur unter den Bedingungen der Creative Commons-Lizenz „BY-NC-ND 3.0“ gestattet. Kommerzielle bzw. sämtliche nicht-private Nutzung, öffentliche Vorführung, Reproduktion und Verwendung auf anderen Websites ist untersagt. Veröffentlichungsjahre 2009 bis 2025. Das geistige Eigentum und die Verantwortung über die Inhalte der Vorträge liegen bei den Vortragenden.